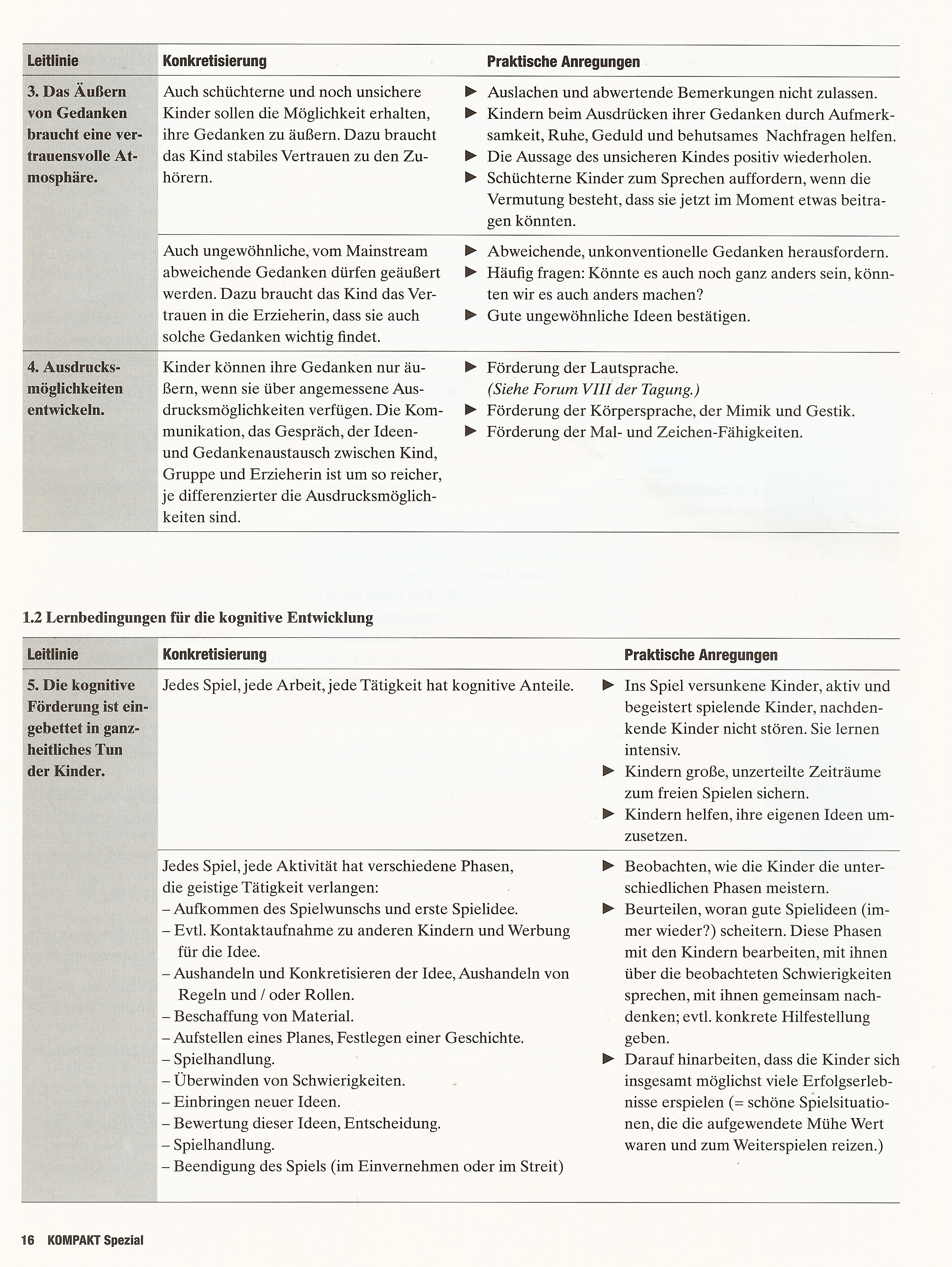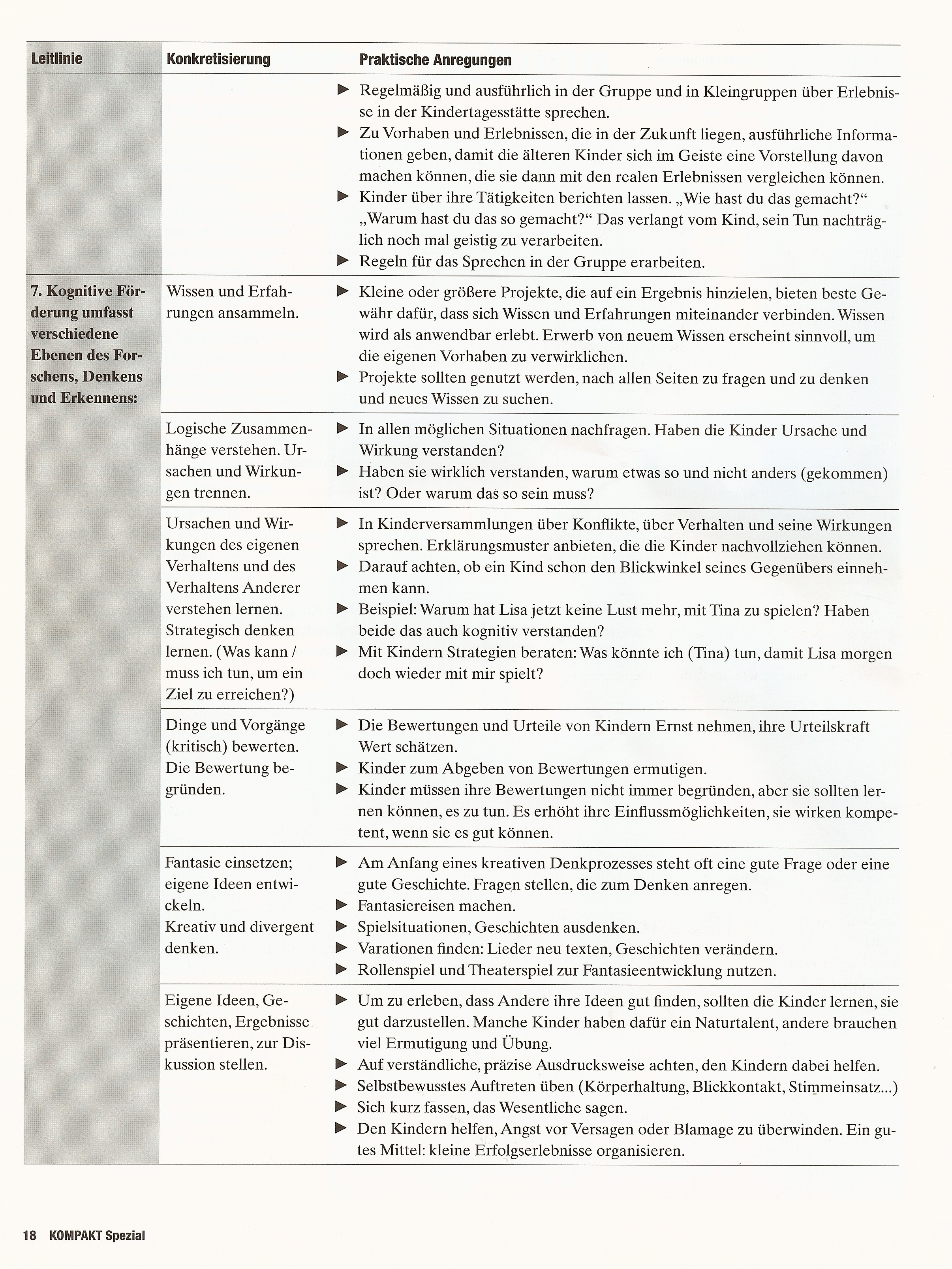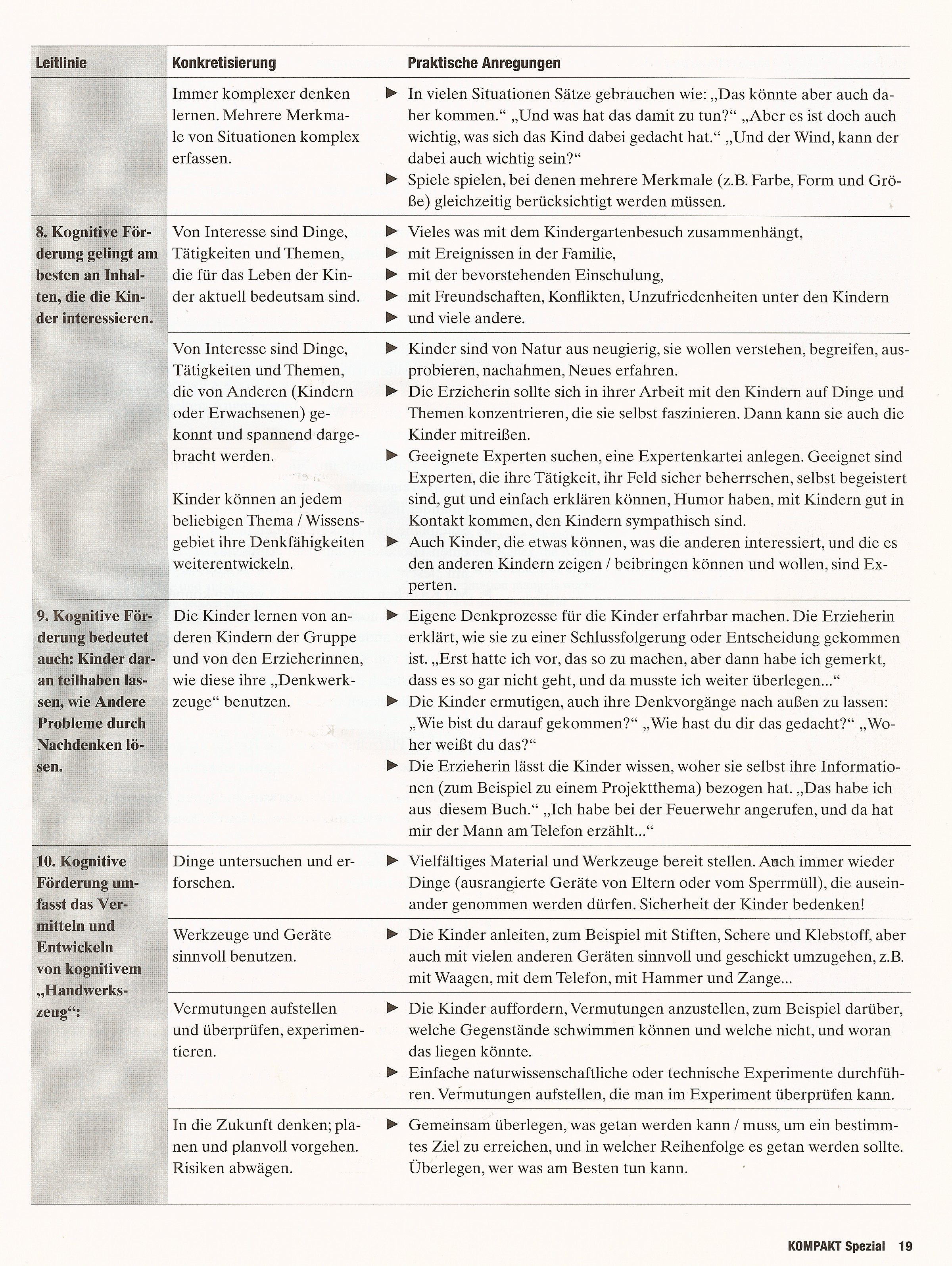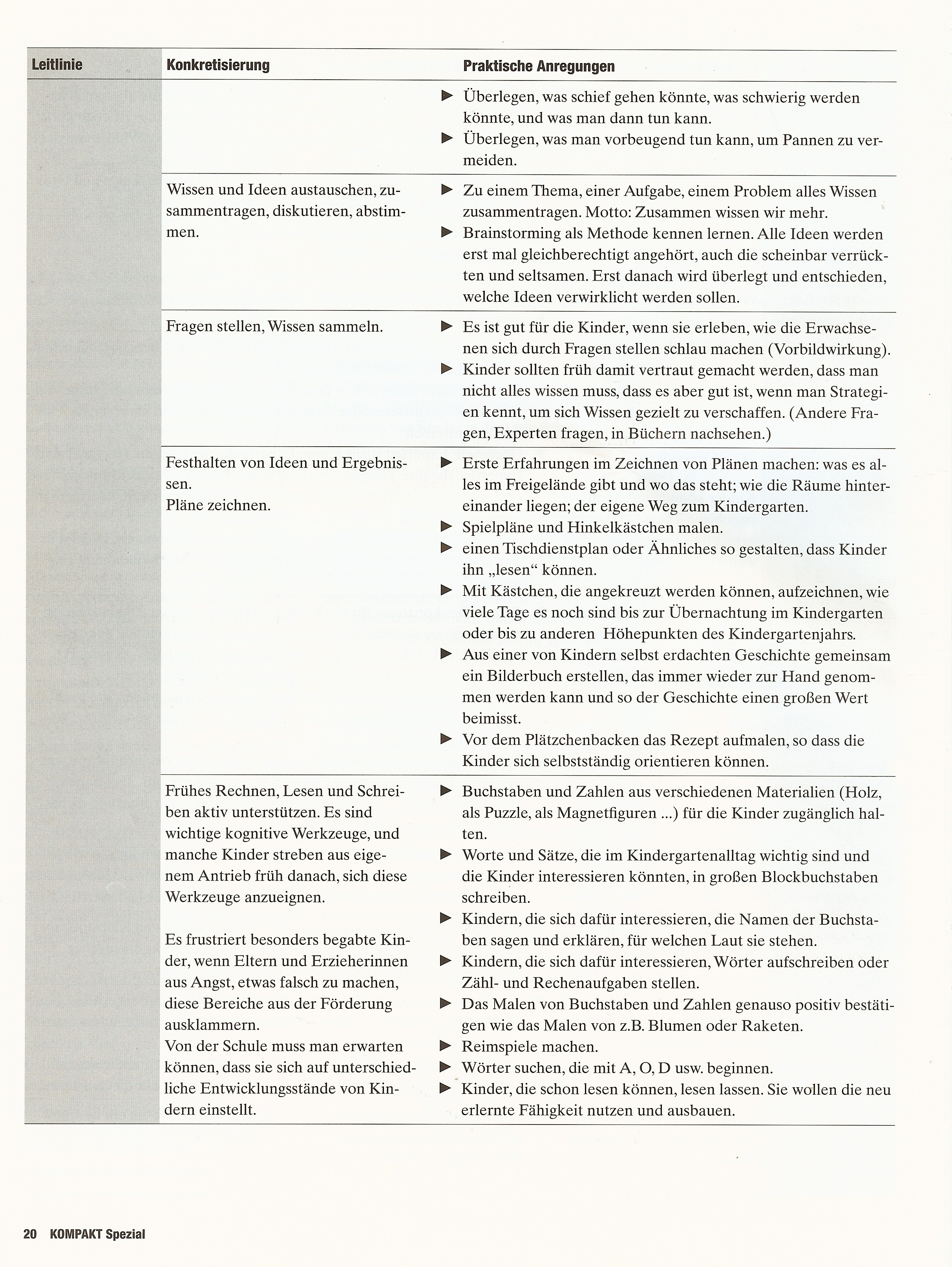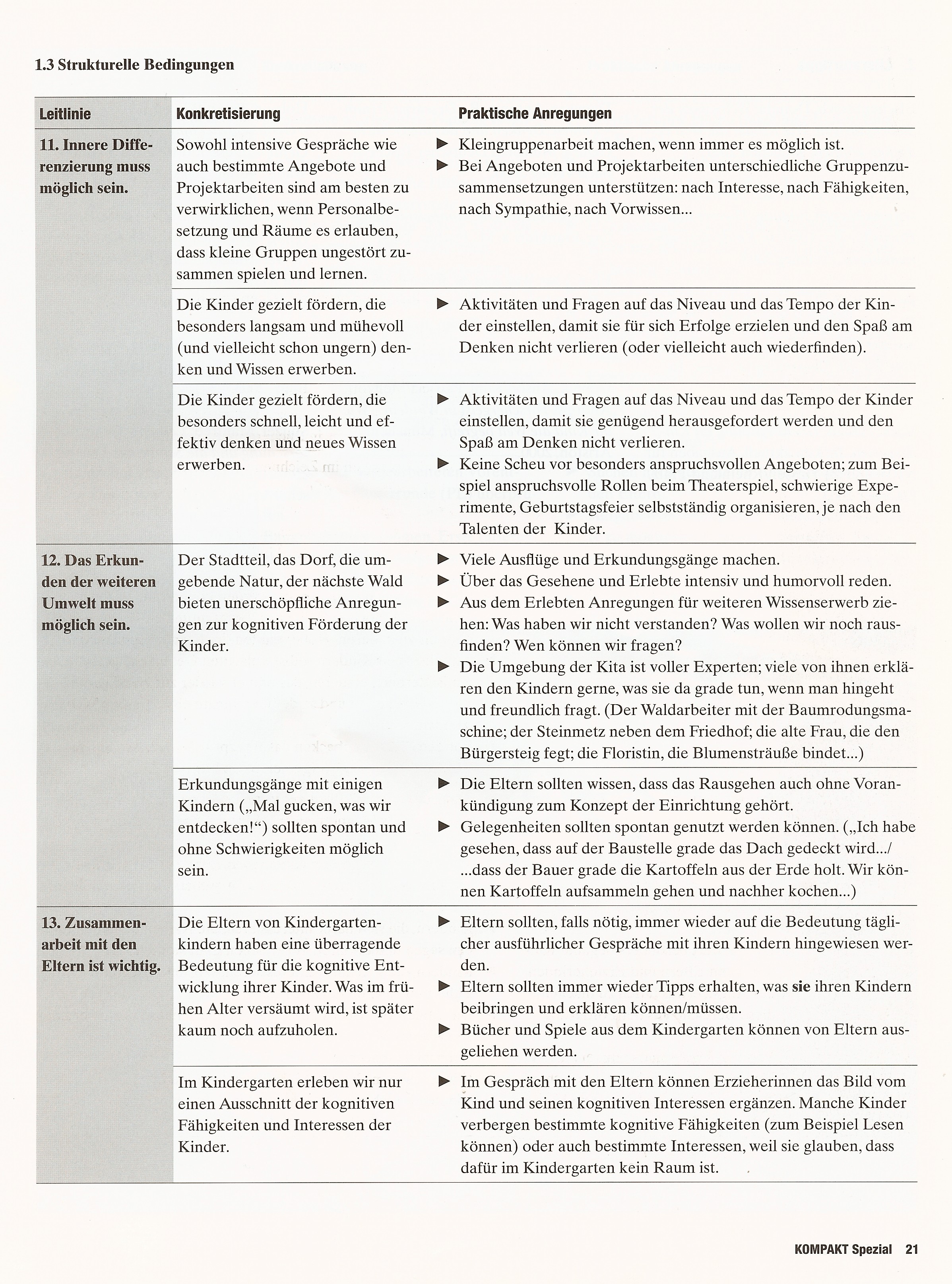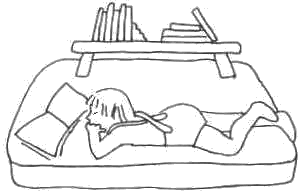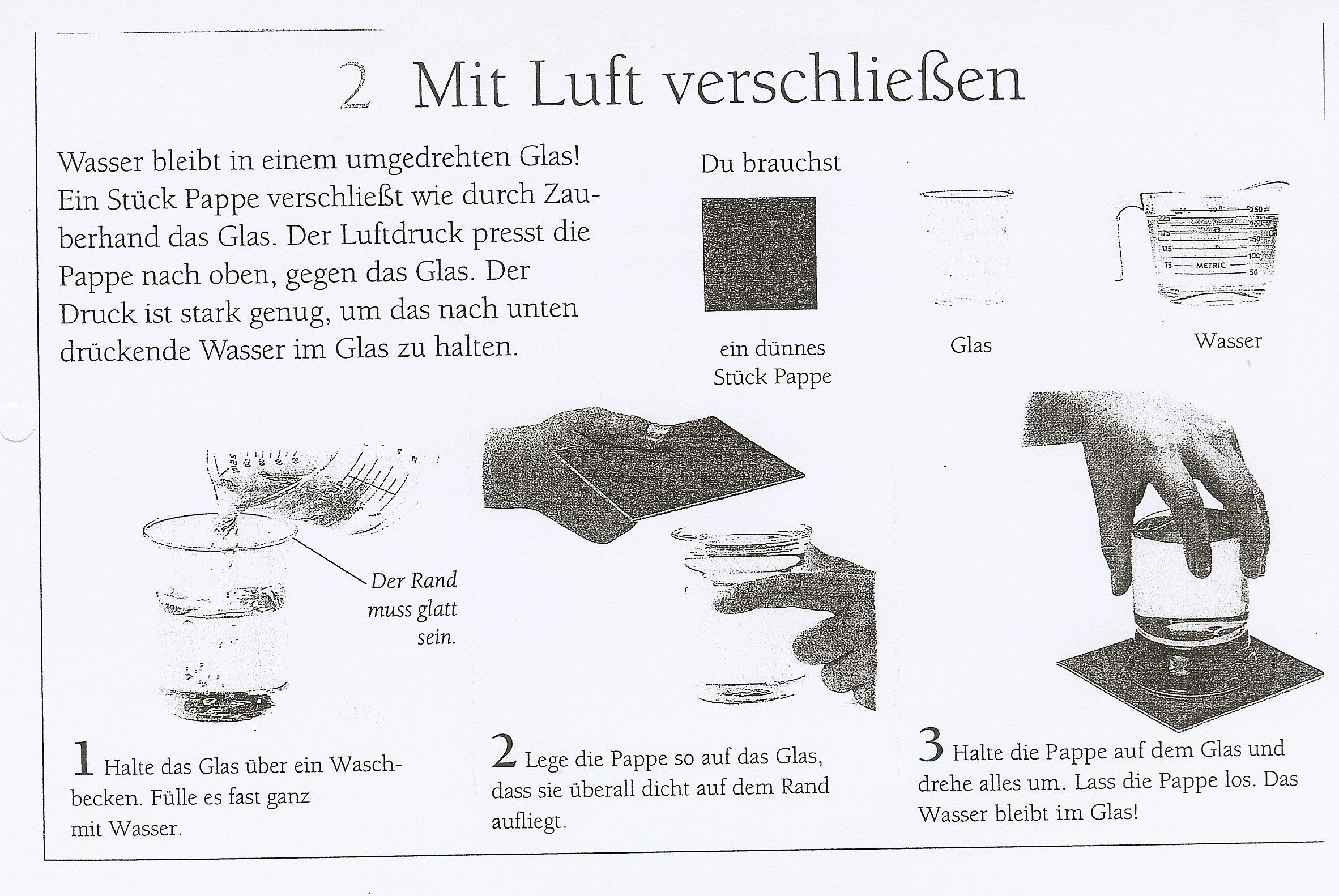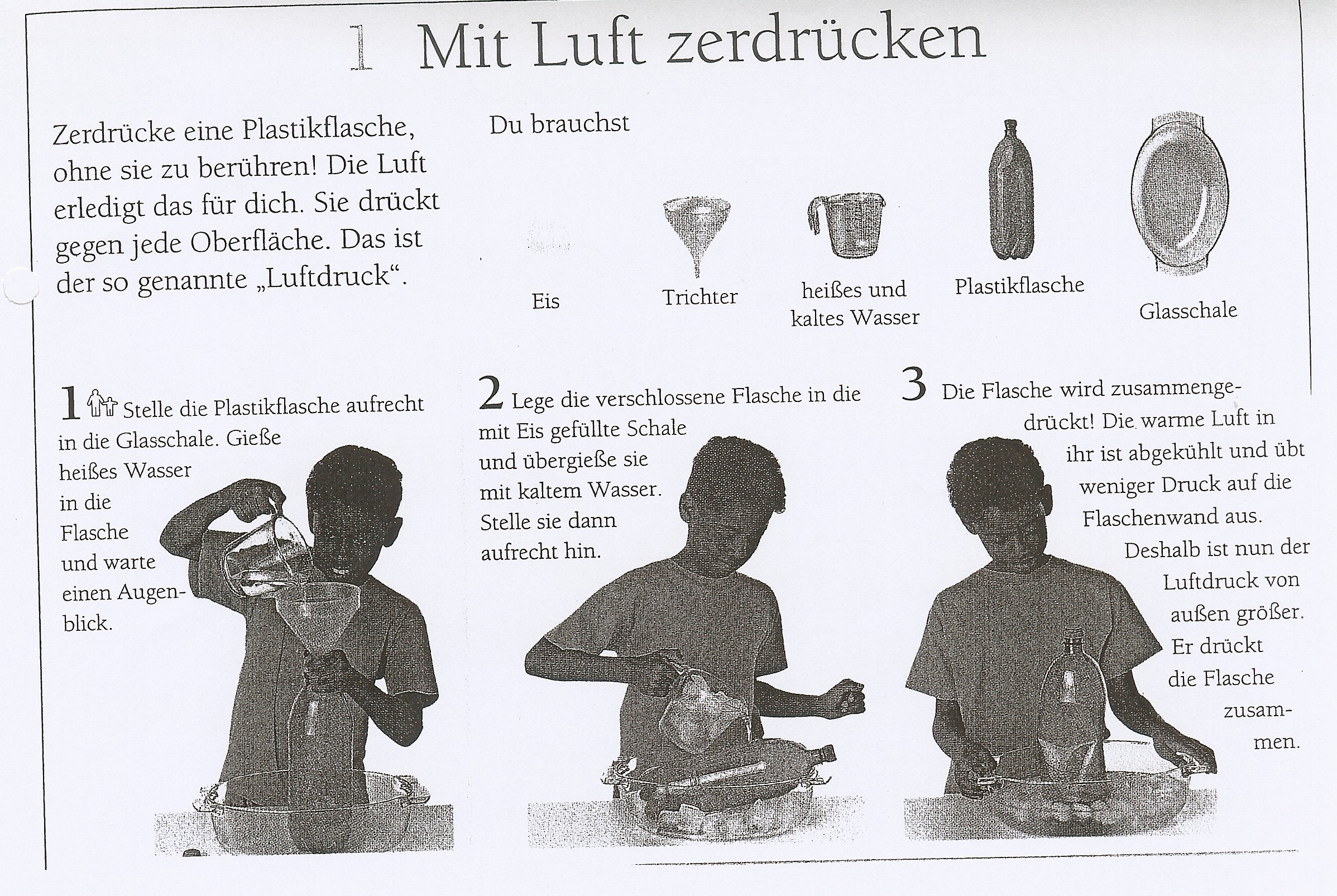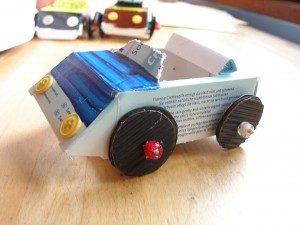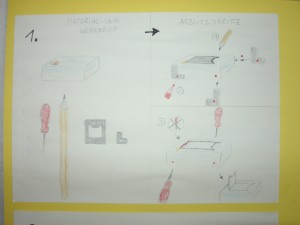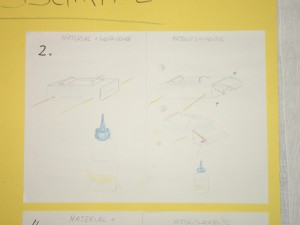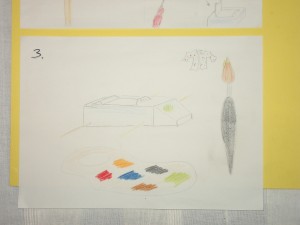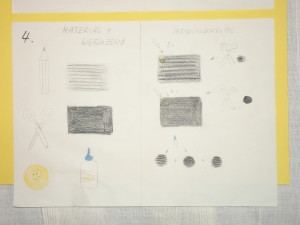von Hanna Vock
Die Verantwortung der Erwachsenen gegenüber Kindern umfasst dreierlei:
Betreuen – Erziehen – Fördern.
Damit diese drei Prozesse gelingen können, müssen Voraussetzungen gegeben sein:
Unbedingt: die vorbehaltlose Liebe der Eltern, die offene emotionale Zuneigung der Erziehenden, Aufmerksamkeit und Zuwendung, Authentizität, der Wille zu Fairness und elementare materielle Grundlagen.
Wünschenswert bei den Erziehenden: eine zumeist heitere, lebensbejahende Stimmung, Vitalität und Humor, materielle Spielräume, Interesse am Lernen und Begreifen.
In diesem Handbuch geht es zwar schwerpunktmäßig ums Fördern, aber auch bei der Förderung hoch begabter Kinder tauchen natürlich immer wieder Erziehungsfragen auf. Und Kindertagesstätten sind ja auch gesetzlich verpflichtet, an der Erziehung der Kinder mitzuwirken, möglichst in enger Zusammenarbeit mit den Eltern.
Es ist auch kein Kita-Tag denkbar, an dem nicht erzieherische Entscheidungen des Teams oder der einzelnen Erzieherin wirksam werden, manchmal auch dadurch, dass wir nichts tun.
Was genau ist Erziehung?
Die Literatur dazu ist tonnenschwer, trotzdem möchte ich meine eigene Sichtweise noch hinzufügen.
Technisch gesehen ist Erziehung absichtliche oder unabsichtliche Verhaltenslenkung.
Kinder werden im Laufe ihrer Erziehung zu bestimmten Verhaltensweisen hin und von anderen Verhaltensweisen weg gelenkt. Dies gilt auch für die Selbsterziehung (oder auch Fremderziehung) des Erwachsenen.
Wohin es geht im Erziehungsprozess, hängt von den Lebenserfahrungen des Kindes (oder auch des Erwachsenen) ab. Auf die Lebenserfahrungen des Kindes, die seine Erziehung prägen, versuchen die Erwachsenen aller Kulturen entscheidend einzuwirken.
Unumstritten ist, dass der Einfluss der Eltern und anderer Personen, die im Leben des Kindes bedeutsam sind, sehr groß ist. Ich halte ihn für ganz entscheidend. Er ist eine große Macht, die nur verantwortungsvoll genutzt werden darf.
Die Grenze zur abzulehnenden Manipulation ist überschritten, wenn das Kind zu einem Verhalten veranlasst wird, das überwiegend den (egoistischen) Interessen des Erziehenden dient. Das Verfolgen egoistischer Ziele in der Entwicklung macht den Erzieher zum Manipulator.
Beispiele: „Ich will erreichen, dass das Kind fügsam ist und meine Bequemlichkeit nicht stört“ – „Ich will erreichen, dass das Kind erfolgreich ist, damit ich mit ihm Eindruck machen kann.“ – „Ich will erreichen, dass das Kind Karriere macht, damit ich es später gut habe.“ – „Ich will erreichen, dass das Kind meine Einsamkeit mildert und mich nicht allein lässt.“
Abgesehen von der Manipulationsgefahr, gilt auch generell: Je weniger verantwortungsvoll oder zielführend die Eltern erziehen, umso wichtiger wird der positive Einfluss anderer Menschen, die dem Kind nahe sind. Manche Eltern wollen das Beste, kriegen es aber bei weitem nicht hin.
Wenn Eltern es nicht schaffen, für ihr Kind ein gut strukturiertes Umfeld zu schaffen, wenn sie in ihrer positiven Zuwendung unzuverlässig sind, wenn die Grundbedürfnisse nur unzureichend erfüllt werden, wenn die Eltern kein gutes Kommunikationsmuster vorleben, dann wird ein „positives Alternativbild“ sehr wichtig.
Das Kind hat nicht nur (neben der Familie) in der Kita einen zusätzlichen Lebensraum, sondern es hat einen, in dem es sich wohl und entspannt fühlen kann, wo es das Muster eines gedeihlichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens kennenlernen und neuartige Anregungen für seine soziale Entwicklung erhalten kann.
Erziehungsziele
Für jeden Erziehenden gilt: Seine Erziehungsziele hängen davon ab, welches Bild er von einem gut erzogenen Kind hat. Dieses Bild ist sein Ziel, ob es ihm nun bewusst ist oder nicht.
Jemand, der mit viel Gleichgültigkeit oder sogar Rücksichtslosigkeit gegenüber Anderen Karriere gemacht oder viel Geld verdient hat, findet es womöglich erstrebenswert, dass auch seine Kinder diese Eigenschaften kultivieren. Er wird vielleicht nicht das Ziel haben, seine Kinder zum Teilen, zum Abgeben, zum achtsamen Umgang mit anderen Menschen, zu Fairness bei der Durchsetzung eigener Ziele zu erziehen.
Schwierig wird es für Kinder, wenn das Eine (Gute) „gepredigt“ wird und das Andere (nicht so Gute) vorgelebt und auch eigentlich vom Kind erwartet wird. Das Kind kann dann nur verzweifeln, sich auflehnen oder ebenfalls lernen zu heucheln.
Da viele unterschiedliche Zielvorstellungen möglich sind, komme ich nicht umhin, mein eigenes Bild eines gut erzogenen Kindes zu entwerfen. Mit diesem Bild müssen meine Leserinnen und Leser natürlich nicht übereinstimmen.
Im Kleinkind- und Kindergartenalter möchte ich nach Kräften dazu beitragen, dass das Kind mit etwa fünf bis sechs Jahren die folgenden sozialen Eigenschaften und Fähigkeiten entwickelt hat:
-
- Es kann seine eigenen Bedürfnisse klar erkennen und vertreten.
- Es hat ein positives Selbstwertgefühl.
- Es kann die Bedürfnisse anderer wahrnehmen und weitgehend achten.
- Es kann um Hilfe oder Auskunft oder Erklärung bitten, wenn es sie braucht.
- Es kann aggressive Impulse meistens stoppen.
- Es kann sich angemessen wehren, wenn es angegriffen wird.
- Es geht grundsätzlich freundlich, offen und unvoreingenommen auf andere Menschen zu.
- Es hat ein ausgeprägtes Empfinden für Recht und Unrecht.
- Es erkennt Regeln an, die ihm einleuchten, und hält sie meistens ein. Es kann Regeln kritisch hinterfragen und gegebenenfalls dagegen oder für eine bessere Regel argumentieren.
- Es kann Wünsche aufschieben, wenn etwas anderes Wichtiges zu tun ist.
- Es kann auf sein Eigentum achten und achtet auch das Eigentum anderer.
- Es kann mit anderen teilen und Freude dabei empfinden. Es macht aus eigenem Antrieb Geschenke.
- Es kann anderen zuhören und sie meistens ausreden lassen.
- Es kann mit anderen friedlich zusammen spielen und zweckmäßig zusammen arbeiten.
- Es kann über einen längeren Zeitraum Freundschaft halten.
- Es kann sich mit Freunden verabreden und zu ihnen halten.
- Es versucht, Streit zu schlichten.
- Es versucht Hilfe zu holen, wenn Jemand angegriffen wird.
Ist Erziehung nötig?
Oft werde ich von Eltern gefragt, was ich von „Erziehung im engeren Sinne“ halte, ob es wirklich nötig ist, „Maßnahmen zur Erziehung“ zu ergreifen, und ob es nicht ausreicht, die Kinder in guten Bedingungen aufwachsen zu lassen.
Meine Antwort ist: Gute Lebensbedingungen, wie oben beschrieben, sind Voraussetzung für gelingende Entwicklung.
Aber ich sehe Eltern (und auch Erzieherinnen) vor die Aufgabe gestellt, alle drei Anforderungen zu erfüllen, damit das Kind alles bekommt, was es zu einer glücklichen Entwicklung braucht:
1. Betreuung.
Dazu gehört:
Lieben; kuscheln;
beschützen; verlässlich versorgen;
eindeutig liebevoll, ehrlich, freundlich und respektvoll kommunizieren.
Auch der Erziehende profitiert, wenn er seine Sache gut macht: Er erntet die Zuneigung des Kindes, seinen Charme, seine Zärtlichkeit.
2. Förderung (Bildung).
Dazu gehört:
Dem Kind aktiv helfen, die Welt (und damit auch sich selbst) immer besser zu begreifen und zu verstehen.
Eine positive (bestenfalls humorvolle) Lernatmosphäre schaffen und die Werkzeuge zur Erkenntnis beibringen.
Auch der Erziehende profitiert: Er entdeckt und lernt mit dem Kind Dinge, die er noch nicht wusste; vieles begreift er besser, indem er es erklärt. Die Fragen des Kindes bringen ihn auf neue Gedanken.
3. Erziehung.
Dazu gehört:
Dem Kind aktiv helfen, sich zu einem sozialen Wesen zu entwickeln,
zu einem fairen, umsichtigen, verlässlichen und angenehmen Zeitgenossen zu werden.
Auch der Erziehende profitiert: Er wird vom Kind erzogen, sich selbst zu überwinden, um die dichten und immerwährenden Versorgungs-, Schutz- und Kommunikations-Bedürfnisse des Kindes verlässlich zu erfüllen. Er lernt eigene Bedürfnisse nach Schlaf, nach Ruhe, nach Hobbys, nach Geselligkeit im notwendigen Maß zurückzustellen.
Er wird dazu erzogen, noch stärker auf eigene Wahrhaftigkeit zu achten, nicht das Eine zu sagen und das Andere zu tun.
Bei alldem kommt es auf das rechte Maß an: Liebe verweigern ist schlimm, aus Liebe erdrücken aber auch; beschützen ja, aber nicht gnadenlos überbehüten, wie es heutzutage oft zu beobachten ist; verlässlich versorgen, aber nicht überfüttern und verwöhnen; kognitiv fördern und dabei weder über-, noch unterfordern…
Nicht unwichtig ist dabei, wie weit die Bezugspersonen ein Gespür dafür haben, wie dringend das Kind Zuwendung braucht. Das kleinste Knötern des Babys, die kleinste Unmutsbezeugung des Kleinkinds als Alarm zu betrachten und sofort zu beantworten, setzt bei dem Kind einen Lernprozess in Gang, der den Erwachsenen später auf die Füße fallen kann.
Das Kind aktiviert dann unter Umständen nicht seine eigenen Selbstberuhigungskräfte, sondern beginnt die Zuwendung auch bei kleinem Unbehagen zu erwarten und zu verlangen; Die Unmutsbekundungen werden gesteigert, in manchen Familien bis hin zu hysterisch erscheinenden, die Umwelt stark belastenden Auftritten des Kindes. Diese Falle ist für sehr aufmerksame und sensible Eltern aufgestellt und schnappt leichter zu beim ersten oder einzigen Kind. Dem Kind wird wenig oder nichts zugemutet, was wiederum zu einem geringen Selbstvertrauen beim Kind führen kann. Es braucht dann dauerhaft sehr viel Hilfe und Rücksichtnahme, um klar zu kommen.
So kommt es manchmal zu dem scheinbar paradoxen Bild, dass Kinder, die zwar in einer verlässlichen und liebevollen Eltern-Kind-Beziehung leben, aber nicht pausenlos „bemuttert“ wurden, oft als stärker und selbstsicherer wahrgenommen werden.
Hier eine gute Balance zu finden zwischen liebevoller, verlässlicher Zuwendung auf der einen Seite und „Zumutungen“ an das Kind, sich selbst (und Anderen) zu helfen, ist eine immerwährende Aufgabe, sowohl in der Familie wie auch in der Kita.
Und wann fängt die Erziehung an?
Betreuen und Fördern beginnen mit der Geburt. Und das Erziehen?
Ich finde, bis zum Alter von etwa zwei Jahren sollten Kinder in vieler Hinsicht „Narrenfreiheit“ haben. (Die Ausnahme ist: Sie müssen schon früher daran gewöhnt werden, ein „Nein“ zu respektieren, siehe unten.)
Sie erleben sich hoffentlich geliebt und sicher und gut versorgt – und machen „ihr Ding“. Sie folgen ihren Impulsen in einer hoffentlich gut strukturierten und anregungsreichen Umgebung, in der ihre Grundbedürfnisse verlässlich erfüllt werden.
Als diese Grundbedürfnisse sehe ich an:
Nahrung,
Sicherheit („auf mich wird gut aufgepasst“),
Bewegung,
Wärme,
frische Luft,
körperliche Nähe zu liebenden Personen,
emotionaler und geistiger Kontakt zu liebenden Personen,
Körperpflege,
ungestörte Ruhe,
eine anregende Umgebung,
viel Freiheit zur Erkundung dieser Umgebung (um die Entdeckerfreude zu erhalten und zu befeuern).
Was genau verstehe ich unter Erziehung im frühen Alter?
1. Erziehung zu immer größerer Selbstständigkeit
2. Erziehung zu sozialem Verhalten
Der erste Punkt ist unkompliziert, wenn es gelingt, Überbehütung zu vermeiden.
Die Ursachen für Überbehütung sehe ich zum Einen in (oft unrealistisch übertriebenen) Ängsten um das Kind, zum Anderen in egozentrischem Verhalten von Eltern, die das Kind an sich binden, um nicht allein zu sein oder um sich durch das starke Kümmern um das Kind unentbehrlich zu fühlen und eine alles ausfüllende Aufgabe zu haben.
Zur Erziehung zu Selbstständigkeit gehören aber nicht nur Freiheiten, sondern auch viel konkrete Anleitung zum Tun. Auch diese Mühe müssen sich Eltern und Erzieher machen.
Auf den zweiten Punkt möchte ich näher eingehen.
Erziehung zu sozialem Verhalten ist, aus einem einjährigen ich-bezogenen kleinen Menschen einen fünfjährigen sozialen kleinen Menschen werden zu lassen, der gut für sich selber einstehen kann und anderen Respekt entgegen bringt.
Die starke Ich-Bezogenheit des Säuglings und des einjährigen Kindes ist sinnvoll: Ein Menschlein mit so wenig Selbstständigkeit muss nehmen, was es kriegen kann.
Es ist niedlich, es kann lächeln, strahlen und glucksen, notfalls muss es schreien und „nerven“.
Seine Wahrnehmungsfähigkeiten, seine kommunikativen und mentalen Fähigkeiten reichen noch nicht aus, um sich anders zu verhalten. So kleine Kinder haben deshalb in sehr vielen Kulturen die oben schon erwähnte „Narrenfreiheit“, sogar bei höheren Säugetieren ist dieses Phänomen zu beobachten.
Das ändert sich beim Menschen im dritten Lebensjahr. Die Erziehung durch die Erwachsenen (aber auch durch ältere Kinder) beginnt beim Zweijährigen.
Die beiden anderen Anforderungen (Betreuen, Fördern) müssen von den Erwachsenen von Anfang an erfüllt werden.
Das frühe „Nein!“
Das erste Erziehungsmittel ist das Wort „Nein“. Manche bevorzugen „Stopp“, weil es nicht so schneidend klingt, wenn es laut gerufen oder mit Bestimmtheit ausgesprochen wird. Ich bevorzuge das stärker alarmierende „Nein“. Eltern, die den rechtzeitigen Einsatz des „Nein“ (oder „Stopp“) – oder seine konsequente und bestimmte Anwendung zur richtigen Zeit – verpassen, haben es später schwer.
Das Nein bedeutet nicht: „Mir passt das (jetzt gerade) nicht“, sondern: „Das ist nicht erlaubt“. Es bezieht sich nicht auf meine Laune, sondern auf eine Norm, die in der Gemeinschaft des Kindes gilt / gelten soll, in der das Kind sich befindet.
Das „Nein“ rechtfertigt sich nur durch ganz, ganz viel „Ja“. Ein Übergewicht des „Nein“ kann kein Kind akzeptieren. Im Vordergrund müssen ganz eindeutig Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten des Kindes stehen, damit das „Nein“, wann immer es notwendig wird, vom Kind befolgt werden kann.
Notwendig ist das „Nein“ nur,
– wenn die Sicherheit des Kindes oder anderer Menschen oder Lebewesen in Gefahr ist,
– wenn Fairness durchgesetzt werden muss,
– wenn bestimmte Dinge vor Beschädigung zu schützen sind,
– wenn die Nerven der Eltern oder anderer Menschen andernfalls überstrapaziert werden.
Das „Nein“ kann schon wirksam werden, auch wenn das Kind den Wortsinn von „Nein“ noch gar nicht versteht. Es sind der alarmierende Ton und die entsprechende Mimik, die ausreichen. Da Kinder unterschiedlich empfindlich sind, reicht bei manchen schon weniger Nachdruck in Stimme und Mimik, andere Kinder brauchen mehr davon.
Von Anbeginn der Menschheit bis heute müssen die Erwachsenen kleine Kinder durch Alarmrufe stoppen, und zwar sobald sich kleine Kinder fortbewegen können. Die Erwachsenen müssen aufmerksam sein und schnell und laut reagieren, wenn ein Kleinkind im Begriff ist, etwas Gefährliches zu tun – in einen Bach fallen, auf einen gefährlichen Felsen klettern, ins Feuer tappen, auf eine Straße laufen. Und – solange dem Kind nicht klar ist, wo die Grenze ist, muss man hingehen und dem Kind helfen, die Grenze zu begreifen.
Dieser Alarmruf wurde und wird nicht nur angewandt, wenn das Kind sich oder andere in Gefahr bringt, sondern auch in Momenten, in denen das Kind anderen gegenüber gerade übergriffig werden will – oder wenn es im Begriff ist, wertvolles Gut zu gefährden. Will ein einjähriges Kind ein anderes in den Haaren ziehen, um eine Sandform zu bekommen, dann sollte man dem Kind Einhalt gebieten – und zwar schnell, möglichst am Beginn der Handlung, und sich hinbewegen, um die Norm „Nein, nicht in den Haaren ziehen“ mimisch und verbal zu bekräftigen.
Das ist anfangs sehr mühsam, aber nur so ist zu verhindern, dass das Kind aus aggressiven Impulsen eine Durchsetzungsmethode entwickelt, die es dann schwer wieder los wird, wenn sie immer mal wieder erfolgreich war. Aber auch das Kind, das (beinahe) Opfer einer Aggression geworden ist, lernt, dass es das Recht auf Unversehrtheit hat (und dass die Erwachsenen es zuverlässig schützen).
Also je sorgfältiger und fleißiger man die Einjährigen erzieherisch begleitet, desto früher kann man sie dann guten Gewissens unbeobachtet lassen.
Das Gute ist: Wenn Kindern früh antrainiert wird, auf ein lautes „Nein!“ mit Innehalten und Abbruch der beabsichtigten Handlung zu reagieren, kann man ihnen mehr (Bewegungs-) Freiheit geben.
In unserem Kindergarten war es gelungen (und sicher in vielen anderen auch), dass es sehr wenige aggressive Übergriffe zwischen den Kindern gab. Und wenn es doch geschah, wusste das angegriffene Kind, dass es sich wehren durfte, ohne dass die Erwachsenen oder die anderen Kinder sein (Zurück-) Schlagen auf dieselbe Stufe wie die Aggression gestellt hätten.
Viele Kinder haben eigentlich ein feines Empfinden für den Unterschied von Aggression und Notwehr. Leider wird dieses feine Empfinden aber häufig dadurch verwirrt, dass ein Erziehender die Grenze vermischt. Ruft der Aggressor nur laut genug „Aber der hat mich auch geschlagen!“, dann hört man nicht selten: „Ihr sollt das Beide nicht tun.“ Juchhu, auf zur nächsten Aggression! – wenn man so davonkommt.
Wie kann der Alarmruf wichtiges Hab und Gut schützen?
Als mein ältester Enkel begann durch unser großes Zimmer, in dem auch meine Arbeitsecke eingerichtet ist, zu rollen und bald auch zu kriechen, hatte er von der Tür bis zu meiner Arbeitsecke 6 Meter zurückzulegen. An der anderen Seite angekommen, lockten Regale mit Ordnern. Sie herauszuziehen und zu zerfleddern wäre für den kleinen starken Jungen ein Leichtes gewesen und überdies in dieser Entwicklungsphase für ihn überaus reizvoll.
An der gegenüber liegenden Seite (6 Meter entfernt) steht auch ein Regal, bei dem die unteren beiden Etagen das Enkel-Spielzeug und nun auch einen Ordner mit altem Schmierpapier enthielten. Dieses Regal, das Spielzeug und der Ordner verkörperten das Ja, das das Nein entschärfte.
Nun wollte ich also eine Grenze ziehen und das Verhalten lenken.
Also legte ich ein auffälliges Band auf den Teppich vor meiner Büroecke. Sobald sich mein Enkel dieser Grenze näherte, rief ich „Nein, nein!“ und spurtete zu ihm, zeigte auf den Teppich hinter dem Band, schüttelte den Kopf und wiederholte mein „Nein“. Dann drehte ich ihn um und zeigte auf den Weg vor ihm zum anderen Regal, verbunden mit einem aufmunternden „Ja.“ Hatte er dieses Regal dann erreicht und begann die Sachen herauszuziehen, dann hörte er wieder ein freundliches Ja. Ich kriegte sogar Lust, mich dazu zu setzen und mitzumachen.
Dieses „Training“ musste einige Male wiederholt werden, dann hatte er begriffen. Kam er in die Nähe des verbotenen Regals, so schüttelte er schließlich von selber den Kopf, lachte, drehte um und „raste“ vergnügt kriechend zu dem anderen Regal. Wir hatten uns verstanden und ich hatte das Gefühl, dass ihm das gefiel. Von da an war die Büroecke tabu – und wenn ein Ball dahin rollte, guckte er mich fragend an und wartete auf mein Ja. Er hatte gelernt, die Grenze zu respektieren.
Schwierig wurde es erst wieder, als ihn der Computer zu interessieren begann. Aber auch da fragte er immer um meine Erlaubnis. Natürlich frage ich heute den Fünfjährigen auch, bevor ich an seine Sachen gehe, zum Beispiel an seine Schulsachen.
Manche denken, wenn sie so etwas lesen, vielleicht an Dressur. Dressur zielt beim Tier (oder beim Menschen) auf ein Verhalten, von dem das Tier nichts anderes hat als ein Zückerchen und die Zuwendung durch den Menschen, auf die es in Freiheit gar nicht angewiesen wäre. Kein Tiger braucht es für ein glückliches Leben, von einem Menschen gekrault zu werden, kein Hund in Freiheit sehnt sich nach dem Schoß eines menschlichen Frauchens.
Man nimmt den Tieren aus mehr oder weniger vertretbaren Motiven die Freiheit, und gibt ihnen eine erträgliche Ersatzwelt, wenn sie sich so verhalten, wie der Mensch es will.
Frühes Verhaltenstraining bei Kindern (was ja viele höhere Tiere mit ihren Jungen auch machen) ist keine Dressur, sondern es hilft den Kindern, sicher zu sein, selbstständig zu werden und in einer (artgerechten) Gemeinschaft wohlgelitten zu sein.
Nicht das Training an sich ist bedenklich, sondern viele Erziehungsziele und Verhaltensanforderungen, die Erwachsene an Kinder stellen. Ich finde es zum Beispiel sehr bedenklich, wenn ein vier- oder achtjähriges Kind sich beim intensiven Spielen nicht dreckig machen darf oder wenn ein lebhaftes, bewegungsfreudiges Kind in der Schule vier Stunden lang auf einem Stuhl sitzen soll.
Und weitere Erziehungsmittel?
Am Anfang stehen also vernünftige Erziehungsziele und daraus resultierende altersgerechte Verhaltensanforderungen, des weiteren das Ja und das Nein und das zugehörige Verhaltenstraining.
Und was kommt dann? Wie arbeite ich weiter auf die Erziehungsziele hin? Welches sind geeignete Erziehungsmittel, mit denen ich auf die Ziele hinarbeiten kann?
Körperliche Gewalt gegen Kinder ist kein Erziehungsmittel, sondern ein Verbrechen.
Das ist unter Pädagogen inzwischen ganz klar, aber doch ist körperliche Gewalt gegen Kinder noch weit verbreitet und es ist noch nicht lange her, da war sie fast selbstverständlich.
Körperliche Gewalt sind nicht nur Schläge und andere tätliche Misshandlungen, auch der Essensentzug (ohne Abendessen ins Bett oder Schlimmeres) oder das Einsperren gehören dazu.
Psychische Misshandlungen sind kein Erziehungsmittel.
Es gibt viele Formen psychischer Misshandlung, mit denen Kinder gefügig gemacht werden sollen; manche sind offensichtlich, manche geschehen verdeckter: Liebesentzug; Drohungen, die Angst machen; Lächerlich machen, Bloßstellen; Herabsetzen; ironische oder sarkastische Bemerkungen; unfreundliche Vergleiche mit anderen, angeblich besseren Kindern …
Hierbei handelt es sich nie um Erziehung, sondern immer um Machtmissbrauch.
Mittel für einen gelingenden Erziehungsprozess
Im Erziehungsprozess enthalten sind mehrere Teilprozesse, die ineinander verwoben sind:
1. Die Entwicklung von Normen und Regeln
Gute Normen des Zusammenlebens werden teilweise einfach überliefert, es reicht, sie sich bewusst zu machen und zu hinterfragen. Andere müssen entwickelt (ausgedacht, diskutiert, ausgehandelt, angepasst und aktualisiert) werden.
Die Erwachsenen (ein Elternpaar, ein Kita-Team) haben die Aufgabe, sich auf gute Normen des Zusammenlebens zu einigen. Wenn die Kinder älter sind, werden sie einbezogen. Vier- bis Fünfjährige können dazu schon eigene gute Ideen haben.
Aus diesen moralischen Normen (zum Beispiel: Wir achten darauf, dass es gerecht zugeht) sind Regeln abzuleiten, die entweder Jeder gleichermaßen einzuhalten hat oder die differenziert ausgelegt sind, zum Beispiel: 1 Erwachsener – 2 Kugeln Eis, 1 Kindergartenkind – 1 Kugel Eis. (Siehe hierzu: Der Zivi wollte zu viel Eis.)
Gerecht kann aber auch sein, wenn das Geld nicht ausreicht und alle Hunger haben, nur den Kindern Eis zu kaufen und die Erwachsenen verzichten zu lassen. (Begründung der Kinder im konkreten Fall: „Erstens müssen wir noch wachsen und zweitens habt ihr das Geld und müsst aufpassen, dass ihr genug dabei habt.“ – Klare Sache.)
Die Regeln sollten von den Kindern akzeptiert werden können; es darf keine unbegründete Regel geben und keine, die die Freiheit der Kinder unnötig beschränkt.
2. die Vermittlung von Normen und Regeln
Normen und Regeln müssen einfach und für die Kinder verständlich formuliert sein. Es muss (durch mühsame Kleinarbeit) sicher gestellt werden,
-
- dass jedes Kind die einzelnen Regeln kennt,
- dass jedes Kind jede Regel verstanden hat und weiß, warum es diese Regel gibt (Zurückführung auf die dahinter liegende Norm),
- dass die Kinder wissen, dass es immer wieder Gelegenheit gibt, über die Regeln zu diskutieren – nur nicht in der aktuellen Situation eines Regelverstoßes.
3. das Durchsetzen der (bekannten und akzeptierten) Normen und Regeln
Die beste Regel nützt nichts, wenn sie nicht auch durchgesetzt wird. Die Kinder verlieren das Vertrauen, dass die Regeln wirklich geeignet sind, die Rechte des Einzelnen zu schützen und ein gutes Miteinander sicher zu stellen, wenn es willkürlich zugeht.
Mal gelten die Regeln, dann wieder nicht – mal gibt es Sanktionen, dann wieder nicht – damit werden die Erziehenden unglaubwürdig.
Das bedeutet nicht, dass überall dieselben Regeln gelten. Kinder können sehr gut akzeptieren, dass zu Hause andere Regeln gelten als in der Kita oder bei den Großeltern oder in anderen Familien.
In unserer Kita war es immer erlaubt, auf Stühle und Tische zu klettern, damit zu spielen, sie woandershin zu schieben. Manchmal wurden sie auch übereinander getürmt. Vor dem Essen wurden sie heiß abgewischt und abgetrocknet und damit war der Hygiene genüge getan.
Manche Eltern taten sich anfangs schwer mit dieser Regel, solange sie befürchteten, dass das Auf-die-Tische-Klettern in die eigene Wohnung überschwappen könnte. Das passierte aber nicht. Die Kinder differenzierten genau und konnten sich hier wie in vielen anderen Situationen auf die unterschiedlichen Regeln einlassen.
Ausnahmen
Ein sorgfältiger Umgang mit Ausnahmen von der Regel ist so wichtig wie die Regel selbst. Natürlich sind Ausnahmen nötig. Sie machen den Umgang mit Regeln rücksichtsvoll, fair und freundlich.
Auf das Dach des Gartenhäuschens darf aus Sicherheitsgründen nicht geklettert werden. Aber jetzt haben wir ein paar große, klettergewandte Kinder, das Dach ist trocken und nicht rutschig und wir haben die Zeit und Gelegenheit, daneben zu stehen und genau aufzupassen, dass kein Kind abstürzt. Also ist es jetzt ausnahmsweise erlaubt.
Andersherum: Es herrscht gerade Personalmangel, die zweite anwesende Erzieherin hat zudem starke Kopfschmerzen und die Kindergruppe ist unruhig, Zank liegt in der Luft. Also wird die Regel: „Ihr dürft immer und überall vor, neben und hinter der Kita, in allen Ecken und Winkeln und Gebüschen spielen“ heute Nachmittag für die letzten beiden Stunden eingeschränkt: „Alle bleiben auf dem Spielplatz vor dem Haus.“ Das muss begründet, aber dann auch durchgesetzt werden!
Ohne Sanktionen geht es nicht
Wenn Kinder – und das ist bei hoch begabten Kindern besonders häufig der Fall – sofort selber wissen, dass sie etwas falsch gemacht haben, erübrigen sich alle „Predigten“, hier reicht ein Blick in das verlegene oder zerknirschte Gesicht des Kindes. Alles darüber hinaus wäre kränkend.
Ist das Kind aber der Ansicht, nichts falsch gemacht zu haben, wird eine Diskussion nötig. Keine Endlos-Diskussion, die manche hoch begabte Kinder wunderbar führen können, sondern eine präzise Klärung der Standpunkte.
Manchmal sind aber auch Sanktionen nicht zu vermeiden – zum Beispiel, wenn das Kind dasselbe negative soziale Verhalten immer wieder zeigt, etwa die übernommene Hausarbeit immer wieder nicht erledigt oder andere Kinder immer wieder ärgert. (Hausarbeit für Fünfjährige könnte in der Familie sein: den Geschirrspüler regelmäßig ausräumen oder das Kinderzimmer aufräumen und staubsaugen oder die Treppe, den Balkon oder die Terrasse fegen oder den Abendbrottisch abräumen und sauber wischen…)
Worin können solche Sanktionen bestehen?
1. kann man natürliche oder logische Folgen eintreten lassen,
2. kann man „Vergünstigungen“ entziehen.
Eine natürliche Folge ist, dass Eltern/Erzieher sich ärgern und ihre Empörung deutlich zeigen, indem sie mit dem Kind schimpfen.
Eine logische Folge auf das versäumte Tisch-Abräumen könnte sein, dass kein Elternteil Lust hat, eine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen, auch wenn die Gute-Nacht-Geschichte so etwas wie ein Gewohnheitsrecht des Kindes ist und es fest mit ihr rechnet.
Wurde das Kinderzimmer nicht in Ordnung gebracht, können Einladungen oder Verabredungen mit Freunden wegfallen, auch wenn das Kind sich schon darauf gefreut hat.
Es wäre eine logische Folge, dass die Eltern, anstatt mit dem Kind ins Schwimmbad zu fahren, auf der Zimmerreinigung bestehen (oder es notfalls in der eigentlich fürs Schwimmbad vorgesehenen Zeit selber machen).
Nach einem wiederholten Ärgern anderer Kinder ist es schwierig, natürliche oder logische Folgen eintreten zu lassen. Hier kann die Sanktion darin bestehen, den Kirmes-Besuch ausfallen zu lassen oder (in der Kita) das Kind vom nächsten Ausflug auszuschließen.
Es ist wichtig, dass dem Kind der Zusammenhang zu seinem Verhalten ganz deutlich wird.
Eine harte, aber oft wirksame Sanktion kann in der Kita darin bestehen, das Kind dem Gruppendruck auszusetzen. Dies erfordert viel Klarheit und Feingefühl auf Seiten der Erzieherin. Beschrieben ist eine solche Situation in dem Beitrag:
Und da waren die Geschenke hin
Die Kinder erziehen sich doch gegenseitig!
Ja, nicht nur die Eltern und Erzieherinnen erziehen das Kind, es wird auch von den anderen Kindern erzogen, auch von gleichaltrigen oder jüngeren.
Nicht immer sieht ein Erwachsener, wie die Kinder miteinander umgehen und kann notfalls intervenieren – und das ist ab etwa drei Jahren auch gut so.
Die Kinder sind in der Lage, ihr Verhalten untereinander zu regulieren und ganz eigene Regeln aufzustellen. Wenn es gut läuft, nehmen sie den Erwachsenen damit auch viel Arbeit ab.
Es läuft dann gut, wenn in der Kindergemeinschaft gut erzogene Kinder den Ton angeben. Eine Kindergemeinschaft ist fast nie egalitär. Immer gibt es einen oder mehrere Anführer und Kinder, die besondere Autorität (oder Macht) besitzen und die Atmosphäre bestimmen.
Wie agieren sie? Welche Normen haben sie im Kopf, welches Verhalten ist ihnen selbstverständlich?
Eltern und Erzieher können sich nicht davon freisprechen, sich darum zu kümmern und notfalls ihre Autorität geltend machen, um die Kinder zu unterstützen, die höhere Ansprüche an ein gutes Sozialverhalten haben. Leider regelt sich das oft nicht von alleine.
Als ich anfing, in meinem Kindergarten zu arbeiten, herrschte dort „Wild West“. Die stärksten Kinder gebärdeten sich recht egoistisch und rücksichtslos: Sie besetzten die begehrtesten Spielecken und Spielzeuge, wann immer ihnen der Sinn danach stand. Sie bedrohten und verjagten andere Kinder und schreckten auch nicht vor Tätlichkeiten zurück. Sie glaubten, es sei ihr gutes Recht (des Stärkeren), sich immer und überall notfalls mit Gewalt durchzusetzen.
Etliche Kinder mieden diese Clique und gingen ihr großräumig aus dem Weg. Sie waren eingeschüchtert und verzichteten auf manches, das ihnen zugestanden hätte. Die Kinder mittleren Alters versuchten sich zu entscheiden: Will ich Opfer oder doch lieber Täter sein? Die Kleinen (Dreijährigen) „hatten gar nichts zu melden“.
Viele Eltern hielten diesen Zustand für normal: „Kinder sind nun mal so!“
Es dauerte einige Monate, bis sich die Verhältnisse änderten. Die rücksichtslosen unter den Vorschulkindern sahen absolut nicht ein, weshalb sie auf ihre Privilegien verzichten sollten und änderten ihr Verhalten bis zur Einschulung fast nicht mehr.
Danach gab es ein kollektives Aufatmen, nicht nur bei mir und meiner Kollegin, sondern auch bei einigen Kindern. Sie hatten bereits begriffen, dass gute Regeln Sicherheit und Gerechtigkeit bedeuten konnten – wenn alle mitmachen.
Von da an wurden wir für unser lustiges und friedliches Kindergartenleben oft beneidet.
Wann ist die Erziehung fürs Erste misslungen?
Ich betrachte die frühe Erziehung (unabhängig von Bildung und Betreuung) als misslungen, wenn sich ein Kind noch mit fünf Jahren immer wieder asozial verhält.
Fast jedes Kind übertritt in diesem Alter hin und wieder Grenzen und verletzt hin und wieder Regeln. Auch das muss schließlich geübt werden, um Ich-Stärke aufzubauen. Aber dazu gehört auch, zu lernen, mit den Folgen (Sanktionen) klar zu kommen.
Diese Prozesse:
-
- das gelegentliche Übertreten von Regeln,
- der Protest gegen die folgenden Sanktionen oder das Abfinden mit ihnen,
- das grundsätzliche Infragestellen von Regeln
sind notwendiges soziales Lernen.
Erwachsenen geht es auch nicht anders; kaum bin ich mit dem Auto zu schnell gewesen, muss ich zerknirscht 25 Euro zahlen.
Dieses „Hin und Wieder“ ist abzugrenzen gegen das gewohnheitsmäßige Missachten von Regeln. Ein Kind, das mit vier oder fünf Jahren sich „mit Leichtigkeit“ immer wieder über die Regeln hinwegsetzt, die für das friedliche Zusammenleben wichtig sind, handelt asozial.
Was bedeutet „asozial“ in diesem Alter? Immer wieder
– andere angreifen, ihnen weh tun wollen.
– das haben wollen, das andere (gerade) haben und brutal und rücksichtslos darum kämpfen (dazu gehört auch ohrenbetäubendes Schreien und Kreischen) – nicht mit anderen teilen können oder oft nicht teilen wollen.
Was ist schief gelaufen?
– Soziale Normen wurden nicht klar oder nicht mit genügendem Nachdruck kommuniziert. Wohlmeinende Eltern finden oft, dass ihr Kind für solche Anforderungen noch zu klein sei. Sie gewähren ihrem Kind zu lange faktische „Narrenfreiheit“.
und / oder
– Es gab negative Vorbildwirkungen von Erwachsenen, von älteren Kindern oder von Gleichaltrigen. Diese Wirkungen waren überwältigend stark oder wurden nicht deutlich genug kritisiert.
und / oder
– Normenverletzungen wurde nachsichtig, schlimmstenfalls sogar tröstend (!) begegnet.
Leider kann schon einer dieser drei Erziehungsfehler ausreichen, wenn er ständig wiederholt wird, um eine asoziale Entwicklung einzuleiten.
Was nun?
Jetzt muss – so schlimm es sich auch anhört – umerzogen werden. Das ist eine mühsame Aufgabe, die es erfordert, dass Eltern und Erzieher sehr aufmerksam sind und bei Normverletzungen sehr schnell und eindeutig reagieren.
Dies muss nun in einem Alter geschehen, in dem Eltern (Erzieher) von gut erzogenen Kindern sich entspannen und die Kinder guten Gewissens über längere Zeit aus den Augen lassen können.
In diesem späten Alter (mit fünf, sechs Jahren) erscheint es mir auch schwerer zu erreichen zu sein, dass die Kinder die sozialen Normen wirklich verinnerlichen und ihnen soziales Verhalten selbstverständlich und zum inneren Bedürfnis wird.
Wehe wenn sie losgelassen!
Wir alle kennen schlecht erzogene Kinder, die „völlig ausrasten können“, wenn sie unbeobachtet oder in einer Gruppe in der Überzahl sind. Kindergeburtstage, Aufenthalte in Jugendherbergen oder ähnliches „entgleisen“ manchmal regelrecht – zum Schrecken von Eltern. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Normen nicht wirklich begriffen, akzeptiert und als Bedürfnis verinnerlicht sind. (Auch das wird gerne entschuldigt: „Wir waren auch nicht besser?!“, „Es sind doch Jugendliche, die müssen sich austoben!“)
Dieses Nicht-Verinnerlichen sozialer Normen kann geschehen, wenn die Erziehungsfehler fortbestehen oder – und vor allem dann -, wenn Kinder/Jugendliche eine deutliche Diskrepanz zwischen den Normen und dem tatsächlichen Verhalten ihrer Erziehungsverpflichteten oder ihrer näheren sozialen Umgebung erkennen.
Dann funktioniert soziales Verhalten nur unter Beobachtung von Stärkeren/Mächtigeren (oder im schlimmsten Fall funktioniert es überhaupt nicht).
Dann haben wir einen jugendlichen oder erwachsenen Asozialen.
Wenn’s bisher gut lief: Die nächste Erziehungsaufgabe
Das gut erzogene Kind hat jetzt eine verlässliche „innere Stimme“ für soziales Verhalten. Die Erziehungsarbeit wäre vollbracht – wäre da bei Vier- und Fünfjährigen nicht noch eine gewisse Verführbarkeit zu asozialem Verhalten. Verführung hat immer einen Zauber. Der Verführer erscheint stark und mutig; er verheißt Spaß, Genuss, Vergnügen, Triumph. Gerne soll man sich zu Spaß, Genuss, Vergnügen und Triumph lustvoll verführen lassen, so lange kein asoziales Verhalten damit verbunden ist. Und es gibt doch wirklich viele sozial verträgliche Quellen!
Gegen Verführung zu asozialem Verhalten aber sollten Kinder „geimpft“ werden.
Die erziehenden Personen, zu denen das gut erzogene Kind ein Vertrauensverhältnis hat, müssen weiter sorgfältig beobachten.
Sie sollten es möglichst bald bemerken, wenn ein anderes Kind oder ein Erwachsener ihrem Kind asoziales Verhalten vorschlägt, zum Beispiel: „Komm, wir machen dem das jetzt kaputt!“ oder „Komm, wir laufen jetzt weg (oder über die gefährliche Straße)“ oder „Komm, wir sagen jetzt (zu einem anderen Kind): Du kriegst nichts von dem Kuchen ab, weil du so hässlich bist“ oder „Wir können das klauen, es guckt keiner“.
Erstaunlich oft wird solches Verhalten als ganz normal für Fünf- oder Sechsjährige angesehen und bagatellisiert.
Wann soll sich das drehen?
Es ist nicht einfach für die Eltern, den besten Freund ihres Kindes zu kritisieren, aber es ist notwendig. Nur so kann das Kind lernen, selbst zu entscheiden und sich notfalls abzugrenzen.
Die Freundschaft muss (es sei denn, es ist krass) von den Eltern nicht in Frage gestellt werden.
Erfährt das Kind die Kritik der Eltern am Freund, kann es entscheiden, ob es die Kritik teilt oder nicht – jedenfalls kann es sich mit seinem Freund auseinandersetzen. Vielleicht ändert der Freund sein Verhalten, vielleicht aber kriegt auch die Freundschaft einen Knacks oder wird aufgegeben und andere Freunde werden gesucht.
Entscheidend ist, dass das Kind in seiner Kritikfähigkeit unterstützt wird, dass es Abgrenzung lernt und dass es lernt, an Freundschaft bestimmte Erwartungen zu knüpfen.
Die Erziehung geht weiter und muss rechtzeitig aufhören
Die moralischen Grundfragen können zwar schon im Vorschulalter geklärt sein – aber es kommen – wie bei uns Erwachsenen auch – immer wieder neue moralische Herausforderungen auf die Kinder zu. Eltern und Lehrer sind in der Pflicht, den Kindern bei der Bewältigung zu helfen, sie aktiv und interessiert zu begleiten.
Manchmal müssen auch im Schulalter noch gut begründete Sanktionen erfolgen.
Meiner Erfahrung nach tritt dann aber bei hoch begabten Kindern spätestens mit 13, 14 Jahren eine Reife ein, die erzieherische Interventionen überflüssig macht. Das Kind ist „fertig erzogen“ und kann seine Entscheidungen nun vollkommen selbstständig treffen.
Besteht zwischen Eltern und der/dem Jugendlichen bzw. zwischen Lehrern oder anderen Personen und den Jugendlichen weiter ein gutes Vertrauensverhältnis, wird sich der/die Jugendliche in einigen Fragen, sicher nicht in allen, Rat oder auch Trost holen. Das setzt voraus, dass der/die Jugendliche bei seinem Gegenüber eine moralische Autorität anerkennt und ihm zutraut, die aktuellen Probleme zu verstehen und diskret und klug beizustehen.
Manche Erwachsene, die von ihrer Nähe her in Frage kämen, den Jugendlichen noch beratend zu begleiten, verspielen den Kredit, indem sie zu viel kontrollieren, argwöhnen oder bevormunden. Das ist für beide Seiten schade.
In glücklicheren Fällen geben die bis dahin Erziehenden ihre führende Rolle rechtzeitig auf und es gibt von da an ein gleichberechtigtes Voneinander-Lernen.
Siehe auch:
Datum der Veröffentlichung: Sept. 2013
Copyright © Hanna Vock, siehe Impressum.