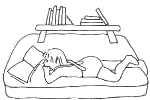zusammengestellt von Hanna Vock und Alexa Kreitlow
In einer Programmankündigung des ARD-Fernsehens haben wir eine griffige Definition gefunden:
„Inklusion bedeutet, dass alle Menschen das gleiche Recht auf volle Teilhabe an der Gesellschaft haben und zwar unabhängig davon, ob und wie stark Einzelne dabei unterstützt werden müssen.
Bestehende Strukturen und Auffassungen sollen so verändert werden, dass die Unterschiedlichkeit der Menschen zur Normalität wird.“
Im Jahr 2009 ist in Deutschland die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten. Das bedeutet, dass Deutschland sich verpflichtet hat, Menschen mit Behinderung so viel gesellschaftliche Unterstützung zu geben, dass sie bestmöglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben und es mitgestalten können.
Die Inklusion voran zu treiben, ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel. Auch ohne den Druck durch die UNO sollte unser reiches Land dabei Vorreiter sein.
In der gegenwärtigen Diskussion haben wir zwei unterschiedliche Auffassungen von Befürwortern von Inklusion gefunden.
Die einen meinen etwa dieses:
Inklusion bedeutet, dass Behinderte (und andere „Randgruppen“) nicht herein genommen werden (zum Beispiel in Institutionen), sondern selbstverständlich drin sein sollen. Der Begriff „Behinderung“ wäre zu ersetzen durch „normale individuelle Unterschiedlichkeit“. Die Idee ist, dass es prinzipiell für jedes Kind das Beste ist, in einem Regelkindergarten und in einer Regelschule betreut und gefördert zu werden.
Für den Elementarbereich ergibt sich daraus: Jedes Kind soll das Recht haben, jeden Kindergarten zu besuchen. Die Eltern können dann ihr Kind – wie alle anderen Eltern auch – im Kindergarten ihrer Wahl anmelden. Kinder mit Behinderung werden als Kinder mit besonderen Bedürfnissen gesehen – nicht als belastend, sondern als selbstverständlich zugehörig zur Gemeinschaft der Kita. Der Kindergarten hat sich auf die besonderen Bedürfnisse des Kindes einzustellen.
Andere meinen etwa dieses:
Inklusion bedeutet:
Die Gesellschaft ist so solidarisch, dass jeder Mensch die Lebensbedingungen vorfindet, die ihm ermöglichen, sich bestens in das gesellschaftliche Leben zu integrieren, an der Kultur teilzuhaben. Es bedeutet, dass Barrieren, die Teilhabe be- oder verhindern, abgebaut werden. Dabei ist „Barriere“ sehr umfassend zu verstehen; es geht nicht nur um abgesenkte Bordsteine für Rollstuhlfahrer, um Tafeln mit Blindenschrift in Museen und um Aufzüge in Schulen. Es geht auch um den Abbau von Unverständnis und Vorurteilen, es geht um Entgegenkommen in der Sprache, zum Beispiel „Nachrichten leicht“ für geistig behinderte Menschen.
Manches davon erfordert „nur“ ein Umdenken und ein neues Gleichwert- und Solidargefühl, anderes verlangt kräftige Investitionen.
Siehe auch: Handbuch Inklusion:
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusion-als-menschenrecht/
Einmal wird also vor allem das Recht aller Menschen betont, in Regeleinrichtungen aufgenommen zu werden, das andere Mal wird die notwendige Veränderung von Rahmenbedingungen betont.
Die Politik wird daran zu messen sein, wie viele Ressourcen sie für diese Veränderungen auszugeben bereit ist.
Der Prozess der Inklusion ist nicht neu, er ist längst im Gange
Gesetze, Baumaßnahmen, gute Ausbildung für Heilpädagogen und Therapeuten, Arbeitsmöglichkeiten für geistig Behinderte und Arbeitshilfen für Körperbehinderte – und viele Formen des selbstverständlichen Zusammenlebens in Vereinen sind Realität.
Im Bereich der Elementarpädagogik gibt es flächendeckend Integrative Kitas, die durch spezielle, qualifizierte Hilfen (z.B. kleine Gruppen, Fachpersonal, das Zusammenleben von behinderten und nicht behinderten Kindern) für behinderte Kinder gute Bedingungen schaffen, auf ein möglichst selbstständiges Leben und bestmögliche Teilhabe an der Kultur hin zu arbeiten.
In NRW – vielleicht auch anderswo – gibt es die sogenannte „Einzelintegration“, die man, wie wir finden, durchaus kritisch sehen kann.
Klar ist: Der Prozess der Inklusion muss energisch und verantwortlich weiter getrieben werden.
Aber wie soll es für den Elementarbereich konkret aussehen?
Leiterinnen haben uns gegenüber geäußert, dass sie die Informationspolitik zu diesem Thema verwirrend finden und nicht wissen, woran sie sind.
Auf unterster Ebene, bei den Kitas, eine „neue Haltung“ einzufordern, löst die Probleme nicht. Es ist nicht hilfreich, sondern klingt in unseren Ohren hilflos und zynisch, wenn einer nachfragenden Kita-Leiterin geantwortet wird: „Es ist eine Frage der Haltung – mit der richtigen Einstellung können Sie die Inklusion in Ihrer Kita auch bewältigen.“
Kita-Leiterinnen, und -Teams, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, finden zwar vereinzelt Aussagen zur Bedeutung von Inklusion und ihren Anforderungen. Was sie aber bisher vergeblich suchen, sind eine umfassende, transparente und einleuchtende Prozessplanung oder auch nur die angedeutete – geschweige denn verbindliche – Auskunft, auf welche zusätzlichen materiellen und personellen Ressourcen sie sich werden stützen können. Ebenso ist unklar, wie die Finanzierung aussieht und wer sie übernimmt. Und wer sind die Ansprechpartner für die Prozessplanung und für auftauchende Probleme? An wen können sich die Kitas wenden?
Trotz dieser weitgehenden Unklarheit kündigte NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann an, dass ab dem kommenden Kita-Jahr (2013/2014 !) alle behinderten Kinder das Recht erhalten, eine Regelkita zu besuchen.
Überschriften von Pressebeiträgen in Nordrhein-Westfalen:
„Inklusion in den Schulen und Kindertagesstätten beginnt 2013“
„Eltern sollen ab 2013 wählen können“
„Inklusion – Selbstverständlich auch bei Kindern unter 3 Jahren“
Wird da Kindern und Eltern etwas versprochen, das nicht zu halten ist?
(Der Termin wurde, soweit wir wissen, um ein Jahr verschoben, aber auch das kommt noch wie ein Schnellschuss daher.)
Was wird nun geschehen?
Seit über 25 Jahren existieren in Deutschland integrative Kindertagesstätten für Kinder mit und ohne Behinderung. Viele Eltern bringen ihre nicht behinderten Kinder dorthin, weil sie die Gruppengröße (15 Kinder, davon 5 behinderte und 10 nicht behinderte Kinder) zu schätzen wissen.
Die Integrativen Einrichtungen sind gut ausgestattet mit Material und vor allem mit Heilpädagogen und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen.
Am Beispiel des Jugendamtsbezirks Rheinland zeigt sich, wie es weiter gehen soll:
In absehbarer Zeit sollen solche integrativen Einrichtungen nicht mehr durch die Mittel des Landschaftsverbandes Rheinland gefördert werden. Das bedeutet, alle Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sollen in Regelkindergärten aufgenommen werden und sollen dort die jeweilige nötige Unterstützung erfahren. Auf viele Kitas wird also eine neue Aufgabe zukommen.
Welche staatlichen Mittel und Maßnahmen sind dafür vorgesehen, um die Erfüllung dieser Aufgabe möglich zu machen?
Wie werden die bisher in den integrativen Einrichtungen tätigen Heilpädagogen und Therapeuten sinnvoll arbeiten können, wenn die Kinder, die ihre Hilfe brauchen, über die ganze Stadt oder über den Landkreis verstreut sind?
Im Bereich des Landesjugendamtes Rheinland (in NRW) gibt es seit dem 1.8.2008 im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) die Einzelintegration. Danach können Kinder mit einer Behinderung in einer Regeleinrichtung aufgenommen werden.
Der Weg zur Einzelintegration ist bisher folgender:
1. Die Eltern fragen in der Kita an, stellen ihr Kind vor und berichten über die spezifischen Hilfen, die ihr Kind braucht.
2. Die Kita kann sich aufgrund von Ausbildung (Heilpädagogen) oder einschlägigen Weiterbildungen ein Bild machen, wie die Alltagsanforderungen (an das betroffene Kind, die anderen Kinder und die Mitarbeiter) aussähe, wenn das Kind aufgenommen würde.
Entsprechend erhalten die Eltern eine vorläufige Antwort: „Wir können es uns vorstellen / Wir können es uns nicht vorstellen.“
3. Nach einer positiven Antwort (Ja, wir können es uns evtl. vorstellen) stellen die Eltern einen formlosen Antrag auf Aufnahme in den Kindergarten an den Kita-Träger.
4. Der zusätzliche Förderbedarf, den das Kind hat, wird von Früherkennungszentren oder ähnlichen Einrichtungen festgestellt.
5. Die Kita entscheidet, ob sie sich in der Lage sieht, diesen zusätzlichen Förderbedarf zu erfüllen. Wenn die Entscheidung wiederum positiv ausfällt, muss die Kita ein individuelles Förderkonzept für das Kind schreiben.
6. Dieses Konzept ist Teil eines Antrages, den die Kita an das Landesjugendamt stellt. Beantragt wird die Genehmigung der Aufnahme des Kindes und zugleich die entsprechenden Unterstützungen, die der Kita in diesem Zusammenhang zustehen.
Dies sind üblicher weise: 9 Personalstunden zusätzlich sowie finanziell die 3,5-fache Kindpauschale.
7. Das Landesjugendamt prüft, ob die Voraussetzungen der Kita und das eingereichte Förderkonzept hinreichend sind und entscheidet über die Aufnahme. Sie erteilt dann für diesen einzelnen Platz eine Betriebserlaubnis.
Dieser Weg liest sich vielleicht umständlich, ist es auch sowohl für Eltern, Kita und Amt – aber so soll gewährleistet werden, dass das Kind die nötige Betreuung und Förderung erfährt und die Kita nicht überfordert wird.
Trotzdem bleiben für etliche Behinderungsarten Zweifel.
Werden die besonderen Bedürfnisse behinderter Kinder erfüllt?
Stellvertretend für viele andere Behinderungsarten sei hier auf die besonderen Bedürfnisse gehörloser und hörgeschädigter Kinder hingewiesen.
Wir möchten aus einem Papier der Deutschen Gesellschaft für Hörgeschädigte einige Passagen zitieren, in der ihre Position zum Thema Inklusion formuliert ist:
„Die Verbände der Hörgeschädigten möchten mit den Bildungseinrichtungen und der
Politik einen gemeinsamen Aktionsplan zur Sicherung der inklusiven Qualität von Bildung entwickeln. Dieser soll unter Einbeziehung qualifizierter hörgeschädigter Fachleute und der Verbände kontinuierlich begleitet und evaluiert werden.“
Offenbar stehen die Verbände der gesellschaftlichen Inklusion Hörgeschädigter positiv und konstruktiv gegenüber und bieten ihre Erfahrungen an. Gleichzeitig können wir Sorge herauslesen; denn die Bedürfnisse der hörgeschädigten Kinder müssen in einem Inklusionsprozess auch abgesichert werden. So heißt es:
„In einer inklusiven Gesellschaft herrscht kein Normalisierungsdruck. Vielfalt in der
Kommunikation wird als Bereicherung geschätzt und gefördert. Die Lernenden sollen
befähigt werden, in altersgemäßer Form den eigenen Bildungsprozess zu gestalten.
Hierzu gehört die freie Wahl der Lernorte und der Unterrichtssprache.
Die Wahlmöglichkeiten sind strukturell und institutionell abzusichern. Dabei spielt die
Qualifizierung der Lehrenden in den Bereichen Audio- und Gebärdensprachpädagogik eine wichtige Rolle.“
Stellt sich für uns die Frage:
Wie wird sichergestellt, dass diese speziell qualifizierten Betreuer, die in speziellen Einrichtungen arbeiten, nun in anderen Kitas in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, sodass das Kind die Audio- oder Gebärdensprache in angemessener Zeit erlernen und dann auch verwenden kann? Woher nimmt das Kind die Motivation, die Gebärdensprache zu erlernen, wenn in seiner alltäglichen Umwelt niemand die Gebärdensprache beherrscht? Es ist ja eine sehr komplexe Sprache, die Erzieherinnen sich ja nicht mal eben so in einer kurzen Fortbildung aneignen können.
Dazu heißt es im Papier der Deutschen Gesellschaft für Hörgeschädigte weiter:
„Inklusion erfolgt nicht von heute auf morgen, sondern versteht sich als Prozess.
Hörgeschädigte Menschen sind Teil dieses Prozesses und müssen für diesen Wandel
ausgerüstet werden. Die Vermittlung sozialer Kompetenzen im Sinne von Empowerment und Ressourcenorientierung muss grundlegendes Ziel der Pädagogik sein.
Eine inklusive Gesellschaft akzeptiert, dass hörgeschädigte Menschen auch ihre eigene Peergroup benötigen und ihre eigene Kultur pflegen. Sie reflektiert ihre alltäglichen Barrieren sowie bewusste und unbewusste Diskriminierungen und versucht diese gemeinsam abzubauen.“
Es wird also darauf hingewiesen, dass die Peergroup, also das Zusammensein des Kindes mit anderen gehörlosen Kindern einen hohen Wert hat. Vereinzelung (die ist ja auch kontraproduktiv zu Inklusion) muss vermieden werden.
Das kommt uns aus der Hochbegabtenförderung bekannt vor – mit dem Unterschied, dass Hochbegabte beim Thema Inklusion nicht genannt werden. Denn:
Hoch begabte Kinder sind in den Kitas schon drin.
Auch sie sind Kinder mit besonderen Bedürfnissen, aber es fehlt auch hier ein offizielles Programm zur Inklusion in die Kitas. Sie sind zwar drin in den Kitas, sind aber dort doch meistens von einer ihnen angemessenen Bildung ausgegrenzt. Und nicht selten sind sie auch in der Kindergruppe weitgehend isoliert.
Wir erleben, dass viele hoch begabte Kinder in den Regeleinrichtungen, wie sie heute bestehen, nicht glücklich werden. Denn: die besonderen Bedürfnisse der Kinder werden sehr oft nicht gesehen und begriffen. Kitas sehen sich oft außerstande, den Bedürfnissen dieser Kinder gerecht zu werden.
Wir wollen für sie qualifizierte Weiterbildung ihrer Erzieherinnen und Erzieher und die Schaffung von Peergroups, in denen sie andere hoch begabte Kinder treffen können. Diesen Ansatz verfolgen wir im IHVO seit über 10 Jahren, zum Beispiel mit dem Konzept „Integrative Schwerpunktkindergärten für Hochbegabung“. Aber landesweit sind wir weit entfernt von befriedigenden Verhältnissen für die hoch begabten Kinder.
Die Problemlagen sind ähnlich
Wenn es für Hochbegabte schon so schwierig zu sein scheint, stellt sich für uns die Frage:
Wie können zum Beispiel für ein gehörloses Kind eine eigene Peergroup und eine eigene Kultur entstehen, wenn ein gehörloses Kind in der Kita und später in der Schule das einzige oder vielleicht eins von zwei hörgeschädigten oder gehörlosen Kindern ist?
Und wie soll es dem Geschehen in unserer Kita folgen können und daraus Nutzen für sein Wohlbefinden und seine Entwicklung ziehen?
Ist es für das Kind genug, wenn alle (oder die meisten) freundlich zu ihm sind und es nicht ausgrenzen wollen?
Wird es nicht automatisch und drastisch ausgegrenzt, wenn es sich, abgesehen von einfachster Kommunikation, nicht sprachlich und damit auch nicht gedanklich austauschen kann?
Auf jeden Fall finden wir das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Hörgeschädigte erhellend. Es sagt – in Bezug auf die Regelgrundschule – Folgendes aus: „Wenn die Kommunikation nicht sicher ist, kommt es zur Überforderung. Ohne Unterstützung und Begleitung wird von dem hörgeschädigten Kind eine einseitige Anpassungsleistung erfordert, die nicht seiner natürlichen sozialen und kognitiven Entwicklung entspricht, zum Beispiel können GrundschülerInnen die Kommunikationssituation in ihrer Klasse alleine noch nicht aktiv gestalten. Hörgeschädigte Kinder fühlen sich daher oftmals isoliert, die Zugehörigkeit zu der Gruppe Gleichaltriger ist häufig eingeschränkt.“
Ungleich größer noch sehen wir das Risiko für ein hörgeschädigtes oder gehörloses Kind, das unter Umständen sogar mehrfach behindert ist, in der Kita.
Denn in den ersten 6 Lebensjahren werden die Kommunikationsfähigkeiten, insbesondere die Sprache, erst aufgebaut. Hier muss der Sprachlernprozess, ob es sich nun um Lautsprache oder Gebärdensprache handelt, spezifisch und umfassend unterstützt werden.
Konsequenterweise empfiehlt die Gesellschaft den Aufbau von Kompetenzzentren und Schwerpunktschulen, in denen eine bestimmte Anzahl hörgeschädigter / gehörloser Kinder gemeinsam mit nicht hörbehinderten Kindern unterrrichtet werden. So kann Beides gewährleistet werden:
1. Der umfassende Einsatz von Lehrern und Betreuern mit Spezialausbildung (zum Beispiel in Gebärdensprache, aber auch anderen speziellen Fähigkeiten und Erfahrungen).
2. Ein Umfeld, das eine Peergroup ebenfalls hörgeschädigter Kinder und Lehrer/Betreuer bietet und zugleich den selbstverständlichen Umgang mit nicht hörbehinderten Kindern und Erwachsenen.
Welch eine Parallele zu unserer Auffassung von guter Hochbegabtenförderung!
Und zum Konzept der „Integrativen Schwerpunktkindergärten für Hochbegabtenförderung“!
Ein solcher Aufbau kann nur als sorgfältig gestalteter, wissenschaftlich begleiteter, personell und materiell hinreichend gegründeter Prozess betrachtet werden.
Nun gibt es ja noch eine lange Reihe anderer Behinderungsarten.
Unserem Eindruck nach sorgen sich die Kitas nicht so sehr um die Inklusion einfach körperbehinderter Kinder, sondern fragen sich viel mehr, wie sie den geistig behinderten und den lernbehinderten Kindern gerecht werden können – und wie und mit welchen Folgen für das Wohlfühl-, Entwicklungs- und Lernklima schwer verhaltensauffällige Kinder inkludiert werden können.
Im Prozess zur Inklusion: Die integrativen Einrichtungen stärken
Ist es sinnvoll, die Integrativen Kitas zu opfern? Ist es nicht ein besserer Weg zur besseren Inklusion, auf den Erfahrungen und Kompetenzen der dort Beschäftigten aufzubauen, die Einrichtungen weiter zu qualifizieren und dort Ressourcen einzusetzen, so dass 1. eine weitere Öffnung zur übrigen Gesellschaft verwirklicht werden kann und 2. die behinderten Kinder noch besser gestärkt und angeleitet werden, sich in die gesellschaftliche Kultur einzumischen?
Ziel muss weiterhin sein, im Einzelfall für jedes Kind sehr kritisch und sorgfältig zu prüfen, ob es besser in einer integrativen oder in einer (reformierten) Regelkita darin unterstützt werden kann, volle Teilhabe an der Gesellschaft zu erreichen.
Und wenn dann ein schlüssiges inhaltliches, strukturelles und finanzielles Konzept erarbeitet ist, werden sich viele Kitas auch mit gutem Gefühl der Herausforderung der Inklusion stellen.
Nachtrag (Dez. 2013):
Es sieht nicht gut aus:
Pressemitteilung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen
Siehe auch den Kommentar von Alexa Kreitlow, Kita-Leiterin.
Datum der Veröffentlichung: Mai 2013
Copyright © Hanna Vock, siehe Impressum